| |
|
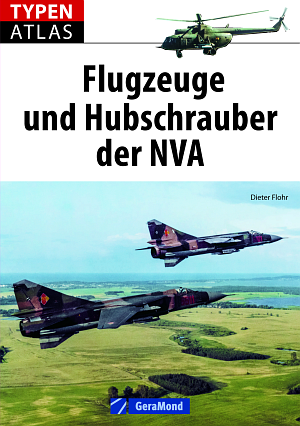
Dieter Flohr
Typenatlas Flugzeuge und Hubschrauber der NVA
GeraMond Verlag 2017
|
|
120 Seiten, Format 16,5 x 23,5 cm, ca. 250 Abbildungen, ISBN 978-3-86245-318-4
|
|
Mit dem Typenatlas Flugzeuge und Hubschrauber der NVA hat
Dieter Flohr, der bisher vor allem mit Publikationen zur Volksmarine der DDR in
Erscheinung getreten ist, sich erstmalig mit den Luftstreitkräften /
Luftverteidigung (LSK / LV) beschäftigt. Die Idee, eine Übersicht über die
Luftfahrzeuge dieser Teilstreitkraft anzubieten, ist dabei nicht neu, wie man
schon einem Blick in das Quellenverzeichnis entnehmen kann. Bereits vor dem
Fall der Mauer wurde ein zweibändiges Werk zu den Luftfahrzeugen der
Streitkräfte der DDR veröffentlicht, das sich durch eine für die
Entstehungszeit ungewöhnliche Offenheit und Detailliertheit auszeichnete. Allerdings
ist das hier besprochene Buch das erste, das diesen Überblick in einem Band
bietet. Ein klarer Vorteil ist die Übersichtlichkeit der Darstellung, die sich
schon aus Platzgründen auf die wesentlichen Fakten beschränkt.
Dem Buch vorangestellt ist ein historischer Abriß, der die
wesentlichen Stationen des Aufbaus der Streitkräfte in der DDR korrekt
wiedergibt und die Entstehung der Luftstreitkräfte als VP-Luft auf 1952
datiert. Insofern ist nicht nachvollziehbar, warum der Rücktitel einen
Überblick über Flugzeuge und Hubschrauber der NVA "von 1949 bis 1989"
ankündigt, zumal im Buch dann weiterhin richtig beschrieben wird, daß die NVA
erst 1956 gegründet wurde. Da davon auszugehen ist, daß mehr als ein
Vierteljahrhundert nach dem Ende der DDR auch jüngere oder mit dem
Innenleben der DDR nicht vertraute historisch Interessierte dieses Buch lesen,
wäre ein Abkürzungsverzeichnis eine wünschenswerte Ergänzung.
Im Typenteil sind jeder beschriebenen Version eines
Flugzeugs oder Hubschraubers ein bis zwei Seiten gewidmet, jeweils ausgestattet
mit Bildern, einem erläuternden Text und einer Tabelle mit technischen Daten.
Besonders interessant sind dabei die Kapitel, die sich mit Fluggeräten
beschäftigen, die auch bei Volksmarine oder im Zusammenwirken mit dieser im
Einsatz waren. Dort bringt der Autor offensichtlich eigene Erfahrungen und
Erinnerungen und damit auch Fakten ein, die dem Rezensenten bisher unbekannt waren.
Erfreulich ist die große Zahl von Fotos aus der Einsatzzeit der Flugzeuge und
Hubschrauber, wobei weniger und dafür größere Bilder sicher einen
Informationsgewinn dargestellt hätten.
Zur Beurteilung der fachlichen Qualität hat der Rezensent,
der durchaus kein Experte in Sachen Geschichte der LSK / LV ist und sich bei
seiner Beschäftigung mit dem Thema immer auf die MiG-21 beschränkt hat, sich
auf die Abschnitte des Buches zu diesem Flugzeugtyp konzentriert.
Dabei werden zahlreiche Schwachstellen sichtbar. Das beginnt bereits mit dem
zweiten Satz zum Thema, wo behauptet wird, daß die ersten Maschinen beim
JG-3 in Preschen eingesetzt gewesen wären. Richtig ist, daß das JG-8 in
Marxwalde die ersten MiG-21F-13 erhielt. Und natürlich endete die chinesische
Fertigung der MiG-21 - sofern das für ein Buch über die NVA überhaupt relevant
ist - nicht bereits "etwa 1995", sondern 2016.
Richtig "wild" wird es dann bei der nächsten
Version, der MiG-21PF, die der Autor unter ihrer in der NVA verwendeten
Bezeichnung MiG-21PFM auflistet. Da sollen dann nur einige PF geliefert und
dann zur PFM "hochgerüstet" worden sein. Und Unterscheidungsmerkmal
wäre das von der Rumpfunter- auf die -oberseite verlegte Staurohr. Das ist
richtig - aber natürlich im Vergleich zur MiG-21F-13. Schließlich versteigt
sich der Autor noch zu der Behauptung, das Radargerät hätte sich als
unbrauchbar erwiesen und die Maschinen wären auf das RP-22 (der MiG-21bis)
umgerüstet worden, was schlicht Unfug ist. Offensichtlich ist ihm auch nie
klargeworden, daß die offizielle Typenbezeichnung MiG-21PFM zu der Version
gehört, die bei der NVA als SPS bzw. SPS-K bezeichnet wurde, denn anders ist
nicht zu erklären, daß im Abschnitt zur MiG-21PF gleich zwei Bilder der
späteren Version auftauchen. Dieses Kapitel dann noch mit einer MiG-21PF mit dem
bundesdeutschen Hoheitskennzeichen (die die ausgesonderten Maschinen offiziell nie erhielten) zu illustrieren,
rundet das traurige Bild an dieser Stelle ab.
Warum im Kapitel über die MiG-21SPS/SPS-K (alias PFM) das
Bild eines Flugzeugführers in der Kabine einer Su-22 erscheint ("zum
Ausgleich" wird im Kapitel zur Su-22 dann eine MiG-21 gezeigt und als
Su-22UM3k beschrieben), bleibt ebenso das Geheimnis des Autors wie die
Wiederholung des bereits zwei Seiten vorher gezeigten Bilds einer landenden
MiG-21U. Der Aussage "Auch hatte der Flugzeugführer nun auf dem Instrumentenbrett
einen Bildschirm des Funkmeßvisiers" möchte man die Frage entgegenstellen:
wo glaubt der Autor, war das entsprechende Gerät der MiG-21PF positioniert?
Heiterkeit verursachte beim Rezensenten die Behauptung, daß mit der Anbringung
eines Tarnanstrichs auf "den Geschwindigkeitsvorteil einer polierten
Außenhaut [...] verzichtet" wurde. Und daß die geringe Reichweite der MiG-21
zunächst (wie es später aussah, verrät der Autor nicht) durch die Leitung vom
Boden aus kompensiert worden sei, provoziert die Frage, ob bei der Jägerleitung
neben Steuerbefehlen auch Kraftstoff übertragen wurde. Auch fragt sich der
Rezensent, der seinen Wehrdienst an der MiG-21bis leistete, welche "ganz
spezielle Höhenschutzanzüge, die an Kosmonauten erinnerten" die
"Piloten dieser MiG-Generation" getragen haben sollen. Und
schließlich sollte jedem, der sich zumindest in Ansätzen Gedanken über
ökonomische Aspekte von Rüstung gemacht hat, klar sein, daß bei einer in mehr als
2000 Exemplaren produzierten MiG-21bis die Zelle nicht "mehrheitlich
aus Titan" besteht. Diese Aufzählung ließe sich fast beliebig fortsetzen
und ist verantwortlich dafür, daß der Rezensent beim Lesen der entsprechenden
Kapitel mehrfach schallend loslachen mußte, bevor das Kopfschütteln wieder die
Oberhand gewann. Übrigens sei an dieser Stelle noch angemerkt, daß die NVA
keine Jagdgeschwader, sondern Jagdfliegergeschwader hatte.
Interessant wäre es noch zu erfahren, wie der Autor auf die
Zahl von 18000 gefertigten MiG-21 kommt. Angesichts von rund 10.600
sowjetischen, knapp 200 tschechoslowakischen und knapp 500 indischen Maschinen
müßten dann also in China fast 7000 J / F-7 gefertigt worden sein, was schicht
illusionär ist.
Angesichts dieser desolaten Darstellung seines "Leib-
und Magenthemas" hat der Rezensent die Kapitel zu weiteren Typen nur
überflogen, ist aber dennoch auf allerlei Merkwürdigkeiten gestoßen.
Dazu gehört die unreflektierte Aussage, daß die LSK / LV mit der MiG-19
"wenig Glück" gehabt hätten. Die erheblichen Verluste sowohl bei
diesem Muster als auch bei den ersten Versionen der MiG-21 sind vor allem auf
eine Überforderung der jungen Armee mit dieser damals sehr modernen und
komplexen Technik zurückzuführen.
Sprachlich leistet sich das Buch zahlreiche Schwächen, so griffen Mi-8TB "im
Rudel" an und eine Su-22 "kommt von der Landung". Britische
Journalisten arbeiten für die "Airforce Mounthly", was kein
Druckfehler ist, da die Bezeichnung gleich zweimal auftaucht. Und natürlich war
die An-2 nicht "der einzige Flugzeugtyp, der bis zum Ende der NVA [...] im
Dienst stand", sondern der einzige, der vom Anfang bis zum Ende in deren
Diensten flog.
Walter Lehweß-Litzmann war kein Jagd-, sondern ein Kampfflieger und wie ihm die
"Sowjets" eine posthum verliehene Auszeichnung (die deutsche Seite
hielt ihn für tot) übergeben haben sollen, bleibt ein Geheimnis des Autors.
Und, und, und ...
Diese Mängel sind sicher nicht nur dem Autor anzulasten. Das
Lektorat und die Bearbeitung im Verlag generell offenbaren (vorsichtig formuliert)
Schwachstellen. Das wird schon deutlich, wenn auf dem Rücktitel von russischen
MIG- statt von sowjetischen MiG-Jagdflugzeuge die Rede ist.
Auch im Text ist die falsche Schreibung mit drei Großbuchstaben hin und wieder
zu finden. Und wenn der Autor - dem Sprachgefühl des Rezensenten
nach korrekt - Antonow mit "w" schreibt, sollte das dann auf dem Einband ebenfalls
so geschrieben werden.
Das Fazit am Ende des Buchs, das die Leistungen der Menschen
würdigt, die die beschriebenen Flugzeuge und Hubschrauber gewartet und geflogen
haben und nochmals die Randbedingungen deutlich macht, unter denen die die LSK / LV
der NVA existierten, schließt das Buch versöhnlich ab, kann aber nicht die
Defizite auf den gut 100 Seiten davor kompensieren. Wer einen allgemeinen
Überblick über die Technik der DDR-Luftstreitkräfte sucht und dabei an vielen
Stellen auf eine sachlich korrekte Darstellung verzichten kann (oder angesichts
des vergleichsweise günstigen Preises will), mag mit diesem Buch auskommen.
Jeder andere Leser sei auf die anderen einschlägigen Werke verwiesen, von denen
sogar das 30 Jahre alte Erstlingswerk qualitativ weit besser ist.
|
|
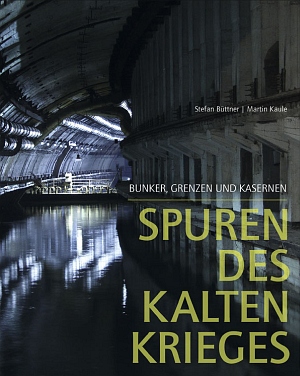
Stefan Büttner / Martin Kaule
Spuren des Kalten Krieges. Bunker, Grenzen und Kasernen
Mitteldeutscher Verlag 2017
|
|
240 Seiten, Format 22.0 × 26.0 cm, 320 Abbildungen, ISBN 978-3-95462-784-4
|
|
Spuren des Kalten Krieges? Mehr als ein Vierteljahrhundert
nach dem Fall der Berliner Mauer, den Umbrüchen in ganz Osteuropa und
schließlich dem Zerfall der Sowjetunion dürften diese weitgehend verschwunden
sein - so sollte man meinen. Doch weit gefehlt: da diese Spuren zumeist in
Beton gegossen sind und deshalb nicht von selbst verschwinden, sind sie noch
immer zahlreich vorhanden. Und sie sind auch deshalb oft noch sichtbar, weil
zwischenzeitlich vielerorts erkannt wurde, daß diese Spuren als wichtige
Zeitzeugen und Mahnmale erhalten werden sollten.
Mehr als 100 solcher Spuren stellen die Autoren vor. Daß es
sich dabei bewußt um eine Auswahl handelt, macht deutlich, daß die Zahl der Hinterlassenschaften
dieser Epoche wesentlich größer ist, als es ein Buch zu fassen vermag. Macht
man sich klar, wieviel Arbeit von Hunderten, Tausenden oder gar Zehntausenden
Menschen in den einzelnen Objekten steckt, wird deutlich, welche ungeheure
Verschwendung menschlicher und technischer Ressourcen die jahrzehntelange
Konfrontation zwischen Ost und West mit sich brachte.
Liest man die Kapitel zu den Schutzbauwerken genauer, wird deutlich, welche
ungeheueren Anstrengungen im Falle der Führungsbunker auf beiden Seiten
unternommen wurden, um jeweils einer kleinen Personengruppe das Überleben eines
Kernwaffenkriegs zumindest für einige Wochen zu ermöglichen. Doch was wäre dann
mit den Überlebenden geschehen, die ihre Schutzbauten irgendwann hätten
verlassen müssen, um die verbrauchten Ressourcen auszufüllen? Und was wäre mit
den Millionen von Soldaten und Zivilisten passiert, für die nur zum Teil oder
auch gar nicht solche Bunker existierten?
Und führt man sich dann noch vor Augen, wie viele der beschriebene Objekte der
Lagerung und dem Einsatz von Kernwaffen mit ungeheurem Vernichtungspotential
dienten, wird klar, wie knapp die Menschheit während des Kalten Krieges einer
Vernichtung - absichtlich oder auch versehentlich entgangen ist. Das sollte als
Mahnung verstanden werden, eine solche Konfrontation zwischen Machtblöcken
nicht wieder zuzulassen - und zwar ganz besonders hier in Europa, wo der Kalte Krieg
am kältesten war, die meisten Spuren hinterlassen hat und angesichts der
erneuten Ausgrenzung Rußlands womöglich vor einer Neuauflage steht.
Besonders herauszustellen ist die Tatsache, daß die beiden
Autoren mit "Spuren des Kalten Krieges" ein umfangreiches Werk
abliefern, das in Zeiten des "Google-Journalismus" im wesentlichen
auf eigenen Vor-Ort-Recherchen basiert. Das Abbildungsverzeichnis belegt dies
ebenso wie die vielfältigen Details, die in den einzelnen Objektbeschreibungen
enthalten sind.
Die Autoren möchten das Buch - so ist es im Vorwort zu lesen
- auch als Reiseführer verstanden wissen, der die Leser animiert, sich zu den
beschriebenen Schauplätzen aufzumachen. Beim Rezensenten hat dies
funktioniert: einige der beschriebenen Orte werden das Ziel künftiger Reisen
sein. Ganz oben auf der Liste: das chinesische Luftfahrtmuseum Datatangshan,
das hier im Buch unter dem Namen der nahegelegenen Basis Shahezhen geführt wird.
Gut, daß zu jedem Eintrag GPS-Koordinaten angegeben sind, die eine eindeutigen
Identifikation und Zielnavigation ermöglichen.
Interessant ist es zu erfahren, daß mittlerweile auch
zahlreiche einschlägige Objekte in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu
besichtigen sind. Diesen hierzulande oft noch unbekannten Anlagen Rußland, der
Ukraine, Kasachstan, Estland, Lettland und Litauen ist rund ein Siebentel des Buchs
gewidmet.
Oft wird der Leser verblüfft feststellen, daß er den
beschriebenen Orten ganz nah war, an diesen vorbeigefahren ist und doch keine
Ahnung hatte, was sich dort verbirgt. Hierzu zählt im Falle des Rezensenten die
Bucht von Kotor in Montenegro, deren U-Boot-Stollen ihm bis zur Lektüre des
Buchs verborgen blieben. Andererseits wird sich mancher Leser auch an eigene
Reisen erinnert fühlen. So erging es dem Rezensenten beim GSSD-Hauptquartier in
Wünsdorf, dem Flugzeugtunnel im albanischen Gjadër oder dem Objekt Vranica auf
dem serbischen Flugplatz Batajnica (wofür aus unerfindlichen Gründen im Buch
die Schreibweisen "Wraniza" und "Batajniza" verwendet
werden). Aus der Sicht des MiG-21-Enthusiasten gehören die letzteren beiden auch
zu den besonders interessanten Orten mit direktem Bezug zum Thema. Weitere sind
das schon erwähnte chinesische Luftfahrtmuseum sowie die Flugplätze in Finow
und Marxwalde (heute Neuhardenberg).
Das Verständnis der historischen Randbedingungen der Entstehung
des jeweiligen Objekts wird durch zeitgeschichtliche Abhandlungen befördert,
die einzelnen Kapiteln vorangestellt sind. Wahrscheinlich hätte es die
Lesbarkeit verbessert, wenn diese Voranstellungen länderweise erfolgt wären.
Besonders deutlich wird dies im Falle von Island, wo einem Absatz zum Objekt
zwei Seiten zum Land vorangestellt werden.
Gewünscht hätte man sich, daß das Inhaltsverzeichnis nicht
nur die erwähnten Länder, sondern tatsächlich auch alle Objekte beinhaltet. Das
Ortsregister am Ende, das die Orte quasi im Fließtext auflistet, ist recht
unübersichtlich.
Schwächen offenbart das Lektorat, wenn im Text einmal vom
sowjetischen "Präsidenten" Josef Stalin gesprochen wird, während das
an anderer Stelle sein Titel als Generalsekretär der KPdSU korrekt benannt
wird. Auch war es nicht Kroatien, das zur Zeit der Entstehung der Kaverne von
Zeljava blockfrei war, sondern das damalige Jugoslawien. Dies sind nicht die
einzigen mindestens unglücklichen Formulierungen im Text, die aber beileibe nicht
den Wert des Buchs mindern - als Reiseführer und zeitgeschichtliche Abhandlung
zugleich.
|
|
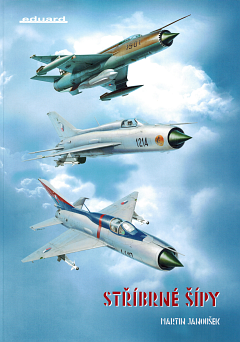
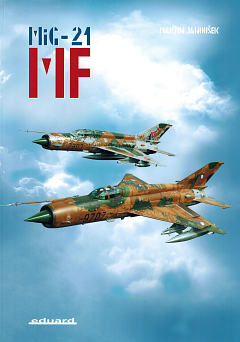
Martin Janoušek
Stříbrné Šípy (Silberpfeile) / MiG-21MF
EDUARD MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. 2014 / 2016
Bausatz Stříbrné Šípy
Bausatz MiG-21MF Limited Edition
|
|
88 bzw. 128 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Format: 21.0 x 29.7 cm
|
|
Jeder, der eine Sammelleidenschaft zu einem Thema entwickelt hat, hat vor allem eines im Auge: die Vollständigkeit der Sammlung. Um diese zu erreichen, muß der
Sammler zuweilen ungewöhnliche Wege gehen, wenn es um Sammelobjekte geht, die ihrerseits ungewöhnlich sind. Für Bücher zum Thema MiG-21, um die es in der Sammlung
des Autors geht, trifft dies beispielsweise dann zu, wenn sie im Buchhandel - auch dem internationalen - nicht erhältlich sind.
Bei den beiden Büchern von Martin Janoušek über verschiedene Versionen der MiG-21 ist dies der Fall, denn diese sind jeweils Teil eines Modellbausatzes von hohem
Qualitätsanspruch (und damit entsprechendem Preis). Wenn auch der Autor, der kein Modellbauer ist, nicht zu beurteilen mag, ob dieser Anspruch von den Bausätzen erfüllt
wird - von den Büchern wird er es auf jeden Fall. Sowohl das Buch zu den tschechoslowakischen "Silberpfeilen", also den MiG-21 der zweiten und - je nach
Betrachtungsweise - der dritten Generation, die mit silberner Außenhaut ausgeliefert wurden als auch das zu den MiG-21MF (das die MiG-21M mit einschließt) in der ČSSR
sowie in den Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei wären gewiß auch ohne den Bausatz Bestseller. Jedes Buch bietet zahlreiche historische Fotos, von denen viele dem
Autor auch trotz langjähriger Beschäftigung mit dem Thema noch unbekannt waren. Viele davon dokumentieren "besondere Vorkommnisse", also Katastrophen und Havarien
(Unfälle mit und ohne Todesopfer), die auch beim Einsatz in den tschechoslowakischen Luftstreitkräften nicht ausblieben. Ebenso interessant sind die zahlreichen Fotos und
Zeichnungen von Sonderbemalungen, die es - anders als bei den LSK / LV der DDR und den anderen Luftstreitkräften des Warschauer Vertrags - bei den PVOS der ČSSR
offensichtlich während der gesamten Dienstzeit der MiG-21 gab.
Erfreulich von den historisch interessierten sind die zahlreichen Erlebnisberichte von Beteiligten, darunter neben Flugzeugführern auch Techniker, der wichtige Teil des Personals,
der oft vergessen wird. Dokumentiert werden ausführlich die einzelnen Lieferungen und ihre Verteilung auf die Regimenter. Daß der Text der Bücher im wesentlichen aus
jeweils sehr umfangreichen Bildunterschriften und nur wenigen reinen Textpassagen besteht, erschwert zwar manchmal den Überblick, macht aber bei genauem Hinsehen den eigentlichen
Wert der Publikationen aus, liefern diese Bildunterschriften doch über Erläuterungen des Bildinhalts hinaus wertvolle Hintergrundinformationen.
Ganz besonders erfreulich für Leser ohne oder mit nur eingeschränkten Tschechisch-Kenntnissen ist eine englische Übersetzung des MiG-21MF-Buchs, die auf der
Eduard-Website verfügbar ist.
Es steht zu hoffen, daß diesen hochwertigen Bausatz-"Beilagen" weitere folgen.
|
|
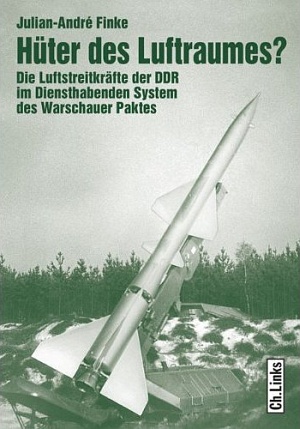
Julian-André Finke
Hüter des Luftraumes? Die Luftstreitkräfte der DDR im Diensthabenden System des Warschauer Paktes
Militärgeschichte der DDR Band 18
Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt
Ch. Links Verlag 2010
|
|
408 Seiten, 19 Abbildungen, Format: 14.8 x 21.0 cm, ISBN 978-3-86153-580-5
|
|
Kaum ein Werk zur Militärgeschichte der DDR wurde bisher so aufgeregt
kommentiert, wie das vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt
herausgegebene Buch "Hüter des Luftraumes?". Dabei schlugen die Wellen
bereits hoch, bevor das Buch überhaupt in den Handel kam. Größter Stein
des Anstoßes war die Tatsache, daß ein Offizier der Bundeswehr, der
zudem noch ein Kind war, als die DDR aufhörte zu existieren, sich der
Geschichte der Luftstreitkräfte / Luftverteidigung (LSK / LV) der NVA
angenommen hatte. Gerade dieser Aspekt ist natürlich absurd: würde man
von Historikern verlangen, Zeitzeugen des von Ihnen erforschten
Geschehens zu sein, reichte die zeitgenössische Geschichtsschreibung
nicht weiter zurück als bis zum Versailler Vertrag.
Obwohl fast 20 Jahre vergangen sind, seit zum letzten Mal Flugzeuge
mit dem Hoheitskennzeichen der DDR starteten, sind in der Zwischenzeit
nur wenige nennenswerte Beiträge zur Aufarbeitung der Geschichte dieser
- gerade nach heutigen Maßstäben - durchaus nicht kleinen
Teilstreitkraft entstanden. 1992 erschien mit dem Buch "Die andere
deutsche Luftwaffe" von Wilfried Kopenhagen die erste Gesamtdarstellung
der Thematik, wenn auch der zeitliche Abstand zum Geschehen noch zu kurz
war, um alle Aspekte der Luftstreitkräfte im östlichen Teil Deutschlands
ausgewogen darzustellen. Trotzdem gebührt dem viel zu früh verstorbenen
Autor das Verdienst, sich als erster den LSK / LV in diesem Umfang
gewidmet zu haben. Wie hoch die Leistung des ehemaligen
NVA-Militärjournalisten Kopenhagen einzuschätzen ist, zeigt die
Tatsache, daß sein Werk - unter dem Titel der späteren Ausgabe "Die
Luftstreitkräfte der NVA" - von Buchautor Finke an zahlreichen Stellen
zitiert wird.
Die Hauptakteure selbst - ehemalige Offiziere der LSK / LV - schwiegen
oder beschränkten sich auf Abhandlungen zu Details ihrer einstigen
Tätigkeit. Erst 2009 legten frühere Kommandeure mit dem Buch "Erlebtes
und Geschaffenes" eine Darstellung der Thematik aus ihrer Sicht vor. Dem
Werk, das im Stile einer Chronik aus NVA-Zeiten verfaßt wurde und das in
unveränderter Form auch vor der Wende hätte veröffentlicht werden
können, fehlt allerdings jegliche kritische Selbstreflexion.
Das im März 2010 erschienene Buch "Hüter des Luftraumes?" will
allerdings keine Gesamtdarstellung der Entwicklungsgeschichte der LSK / LV
sein, sondern untersucht die Souveränität der DDR anhand des Merkmals
Lufthoheit. Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: Autor Finke weist
schlüssig nach, daß die Lufthoheit der DDR anfangs nicht existent und
zum Ende immer noch stark eingeschränkt war, wobei der
Verantwortungszuwachs des Militärs der DDR sowohl dessen gewachsenen
Fähigkeiten und Selbstbewußtsein als auch der zunehmenden ökonomischen
Schwächung der Sowjetunion geschuldet ist. Die fehlende Souveränität
entspricht durchaus dem Erleben eines jeden DDR-Bürgers, auch wenn
Militärangehörige, die wie der Rezensent an untergeordneter
Stelle im DHS standen, angesichts der zahlreichen Alarmierungen und der
ständigen hohen Bereitschaftsstufen das Gefühl haben mußten, daß der
Schutz des Luftraums der DDR ganz allein auf den Schultern der LSK / LV
ruht.
Bei seinen Recherchen greift der Autor im wesentlichen auf Dokumente
der LSK / LV selbst zurück, die im Bundesarchiv / Militärarchiv verfügbar
sind. Auf Grund dieser Tatsache und nicht zuletzt der Fülle des
eingearbeiteten und zitierten Materials ist allerdings doch eine
Geschichte der LSK / LV entstanden, die zudem - hier wird die Voreiligkeit
der anfangs erwähnten Kritiker deutlich - über weite Bereiche die eigene
Sicht der DDR-Luftstreitkräfte darstellt. Die massive Verwendung von
NVA-Quellen stellt aber auch ein Problem dar - vielen Schlußfolgerungen
des Autors, die auf den eher spärlich zitierten westlichen Quellen
beruhen, fehlt so die Legitimation durch entsprechend ausführliches
Material der anderen Seite. Auch wird die Allgemeingültigkeit einiger
Aussagen zu den LSK / LV dadurch eingeschränkt, daß nur Quellen zu
ausgewählten Einheiten berücksichtigt wurden, was aber angesichts der
Zielstellung durchaus legitim ist. Kleinere Schwächen leistet sich das
Werk bei Aussagen zur Technik, die zudem zuweilen auf zweifelhaften
Quellen basieren.
Demjenigen, der zur Gewinnung der genannten Erkenntnis das Studium
von mehr als 300 Seiten Text scheut, sei die Lektüre der beiden
abschließenden Kapitel empfohlen. Im vorletzten Abschnitt arbeitet Autor
Finke zunächst heraus, daß auch die BRD auf Grund alliierter
Vorbehaltsrechte das Air Policing bis zum Abschluß des
Zwei-plus-Vier-Vertrags 1990 nicht in nationaler Verantwortung
durchführen konnte und demzufolge nicht nur die DDR in ihrer
Souveränität massiv eingeschränkt war, stellt aber zugleich klar daß
sich die Strukturen und Mechanismen von Warschauer Vertrag und NATO
sowie die Einflußmöglichkeiten der beiden deutschen Staaten innerhalb
ihrer Bündnisse unterschieden. In den Schlußbetrachtungen schließlich
faßt er die Ergebnisse seiner Recherchen auf wenigen Seiten stringent
zusammen und arbeitet dabei nochmals auch Absurditäten heraus, wie die
Tatsache, daß die Entscheidung über die Vernichtung von
Luftraumverletzern ausschließlich dem Oberkommandierenden der Gruppe der
sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) zustand, die DDR aber
für diese Handlungen die völkerrechtliche Verantwortung zu tragen hatte.
Die durch den Titel des Buchs implizierte Frage, ob die LSK / LV
tatsächlich "Hüter" des eigenen Luftraumes waren, beantwortet der Autor
hinsichtlich des eigenen Beitrags der DDR zum DHS positiv, um aber
gleich anzufügen, daß die Luftstreitkräfte der NVA eben nicht Herren im
eigenen Haus waren.
Ein lesenswertes Buch, das deutlich macht, wie sehr die Souveränität
der DDR in politischen und militärischen Fragen eingeschränkt war.
Interessant wäre es, die Beurteilungen des Handelns führender
politischer und militärischer Repräsentanten der DDR, wie sie z.B. in
den Mauerschützenprozessen vorgenommen wurden, unter diesem Aspekt einer
Neubewertung zu unterziehen. Aber das ist dann schon wieder Stoff für
ein neues Buch ...
|
|
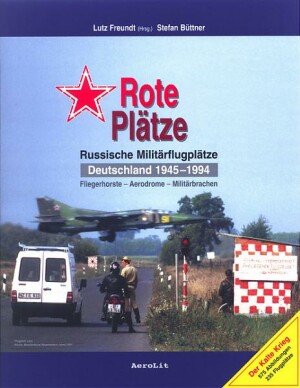
Lutz Freundt (Hrsg.), Stefan Büttner
Rote Plätze
Russische Militärflugplätze
Deutschland 1945 - 1994
Fliegerhorste - Aerodrome - Militärbrachen
Aerolit-Verlag 2007
|
|
300 Seiten, 575 Abbildungen, darunter 110 Luftbilder, Format: 26 x 20 cm,
ISBN: 978-3-93552-511-4
|
|
Die erste wirklich umfassende Darstellung zur Thematik der sowjetischen / russischen Militärflugplätze in Deutschland beleuchtet nicht nur die
Stationierung von Fliegertruppenteilen und ihrer Technik, sondern geht vor allem intensiv auf Entwicklung, Gestaltung und
Funktion der Infrastrukturelemente (Flugbetriebsflächen, Gebäude und Schutzbauten) ein.
Hervorzuheben ist besonders die Systematik, mit der sich die Autoren des Themenkomplexes annehmen: Beginnend mit den sowjetisch besetzten Flugplätzen in
den früheren deutschen Ostprovinzen sind die Flugplatzbeschreibungen nach Regionen gegliedert. Den Kapiteln zu den Objekten in der SBZ, DDR und
BRD wurde eine systematisierende Beschreibung der Infrastrukturelemente vorangestellt, die das Verständnis der folgenden Kapitel erleichtert. Die
einheitliche Gliederung aller Flugplatzbeschreibungen in die Punkte Lage, Start- und Landebahn, Geschichte, Infrastruktur,
Betrieb (stationierte Truppenteile / Flugzeugtypen) sowie Nachschau und die durchgängige(!) Hinterlegung dieser Aspekte mit Fakten
verdeutlicht, welche ungeheure Menge an Material die Autoren bei ihren Recherchen zusammengetragen haben.
Dem hohen Anspruch, den sich die Autoren im Vorwort auch und gerade in Abgrenzung von der heutigen Hobby- und massenmedialen Geschichtsschreibung stellen,
wird das Werk in vollem Umfang gerecht.
|

| |
|